Wer sich der Arbeit entzog, weil er körperlich nicht konnte oder eine andere Arbeit lieber machen wollte, wurde bestraft. Die Folgen waren von Willkür und Terror geprägt und brachten in vielen Fällen den Tod.
Das Menschenbild im Nationalsozialismus duldete kein Verhalten jenseits der von der Ideologie vorgegebenen Verhaltensnorm. Jegliche Abweichung war verboten, wurde verfolgt und bestraft. Die sogenannte „Volksgemeinschaft“ stand über dem Einzelnen. Der Geschichtswissenschaftler Wolfgang Benz hat diesen Sachverhalt wie folgt gefasst:
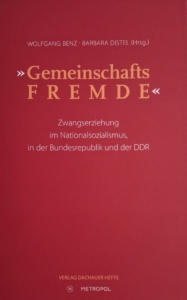
Zwangserziehung im Nationalsozialismus, in der Bundesrepublik und in der DDR.
„Ein Regime, dessen Ideologie sich auf das Recht des Stärkeren, Freund-Feind-Denken und den Anspruch universaler Verfügbarkeit über Menschen gründete, musste der Disziplinierung und Formierung der Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit widmen. Ausrichtung, weltanschauliche Schulung waren die Vokabeln dafür. Dem stand die Ausgrenzung, Unterdrückung und Verfolgung von „Fremden“, ideologischen Gegnern, von allen gegenüber, die nicht dazu gehören wollten oder sollten.“ (Benz, 2016. S.11)
„Universale Verfügbarkeit“ und der Faktor Arbeit im Nationalsozialismus
Diese „universale Verfügbarkeit“ des Menschen zeigte sich vor allem an einem grundlegenden Faktor, der Gesellschaft und Ideologie verband und im Nationalsozialismus zentral war: Es war die Arbeit als produktive Kraft. Damit verbunden war der auf dem Recht des Stärkeren fußende Wettbewerb, verstanden als gnadenlose Auslese unter der werktätigen Bevölkerung. Damit eng verbunden war die Ausbeutung der vom Nationalsozialismus als politische Gegner ausgemachten Menschen. Dazu zählten Menschen aufgrund ihrer Nationalität oder ihrer von den Nationalsozialisten ausgemachten sogenannten „Rasse“. Sie galten als wertlos. Davon waren ausnahmslos die jüdischen Menschen aus Deutschland und Europa betroffen. Dem Mord an ihnen ging vielfach die Vernichtung durch Arbeit voraus. Darüber hinaus richtete sich der Rassismus der Nationalsozialisten gegen Menschen aus Osteuropa, aber auch gegen die nicht-jüdische, deutsche Bevölkerung. Es konnte jede:n treffen, der sich der Erwartung einer „universalen Verfügbarkeit“ aufgrund seiner Lebensweise entzog oder ihr, aufgrund seiner körperlichen oder geistigen Verfasstheit, wozu auch das Lebenalter zählte, nicht entsprechen konnte. Diese Menschen gehörten zu denen, die von den Nationalsozialisten als „Gemeinschaftsfremde“ bezeichnet wurden.
Dazu zählte die Minderheit der Sinti und Roma, die nicht nur von der NS-Ideologie aus „rassischen“ Gründen ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden, sondern auch wegen der gewählten Lebens-und Arbeitsweise als ambulante Händler, Wanderkino- oder -theaterbetreiber und Schausteller der gesetzten Arbeitsnorm nicht entsprachen. Wer dieser Vorgabe nicht folgte, stand für die Nationalsozialisten gegen die Gemeinschaft und die darin geltende Ordnung. Dafür hatten die Nationalsozialisten einen Begriff: „asozial“. Eine Recherche der Landeszentrale für politische Bildung ergab, dass im Saarland zwischen 1935 und 1945 rund 200 Menschen, mehrheitlich Männer, aber auch Frauen, als „Asoziale“ oder „Berufsverbrecher“ stigmatisiert und mit Haft in einem Konzentrationslager belegt worden waren. Rund ein Viertel der Betroffenen überlebte die Inhaftierung nicht.
Die Markierung als „asozial“ und die Folgen für die Betroffenen
Arbeit war grundlegend, wenn es um den Erhalt der von den Nationalsozialisten vorgegebenen Ordnung der Gesellschaft ging. Arbeit stabilisierte diese, und wer nicht arbeitete, stellte sich gegen die Ordnung und wurde mit dem Stigma „asozial“ belegt. Dazu hieß es im Grunderlass „Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ vom 14. Dezember 1937:
„Als asozial gilt, wer durch gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht verbrecherisches Verhalten zeigt, dass er sich nicht in die Gemeinschaft einfügen will. Danach sind z.B. asozial a) Personen, die (…) sich der in einem nationalsozialistischen Staat selbstverständlichen Ordnung nicht fügen wollen (…).“
Wer nach Ansicht des Vorgesetzten zu langsam arbeitete, machte sich der „Arbeitsbummelei“ schuldig. Wer keine Arbeit annahm oder diese wieder aufgab, betrieb „Arbeitsverweigerung“. Wer seinen Arbeitsplatz ohne Erlaubnis des Arbeitsamtes wechselte, beging „Arbeitsvertragsbruch“. Wer an seinem Arbeitsplatz einen Fehler machte, der zur Unterbrechung oder Zerstörung der Produktion führte, konnte der „Arbeitssabotage“ bezichtigt werden.
Diese Beschuldigungen waren willkürlich und entbehrten vielfach einer rechtlichen Grundlage. Die Betroffenen wurden nicht vor ein Gericht gestellt, sondern ohne Verhandlung auf Befehl der Kriminalpolizei und nach 1941 von der Gestapo in ein Konzentrationslager eingewiesen. Es waren Maßnahmen, wie sie in einem von dem Juristen Ernst Fränkel sogenannten „Maßnahmenstaat“ üblich waren. Das hieß, anstatt von Rechtsnormen als Grundlage staatlichen Handelns, galten nun auf Willkür fußende Maßnahmen, wie zum Beispiel die sogenannten „Aktionen“ auf Initiative von Gauleitern bzw. NS-Funktionären oder der Polizei. Dazu zählten die im April und Juni 1938 statthabenden Aktionen „Arbeitsscheu Reich“ und „Arbeitszwang Reich“. Sie führten dazu, dass Männer, die arbeitslos waren, von der Fürsorge lebten, ihren Unterhalt nicht zahlten, ihren Arbeitsplatz ohne Erlaubnis änderten oder diesen zu häufig wechselten, oder zu langsam arbeiteten, verhaftet und in ein Konzentrationslager eingewiesen wurden. Dort blieben sie ein Jahr in Haft und mussten Zwangsarbeit leisten. Im Gegensatz zu späteren Jahren, als sogenannte „Asoziale“ in Konzentrationslager eingewiesen wurden und dort mit einem schwarzen Winkel gekennzeichnet wurden, kamen die bei diesen Aktionen verhafteten Menschen wieder frei. Jedoch gingen auch viele dieser Männer unter den brutalen Bedingungen in diesen Lagern zugrunde und erlebten ihre Freilassung nicht mehr.
Das Jahr 1938 gilt als der Wendepunkt im Umgang mit sogenannten „Asozialen“
„Das Jahr 1938 steht für das Ende der fürsorglich-autoritären Asozialenverfolgung. Die Kriminalpolizei, nicht mehr die kommunale Fürsorge greift nun ein. Asozialenverfolgung obliegt der Reichskriminalpolizei.“ (Hörath, 2017, S. 61)
Die Einweisung in ein Konzentrationslager ist dafür ein Beleg. Die auf im Schnitt ein Jahr angelegte Strafmaßnahme wurde ab dem Jahr 1941 durch ein weiteres Instrument und um einen neuen Akteur auf dem Gebiet der Verfolgung von sogenannten „Asozialen“ erweitert.
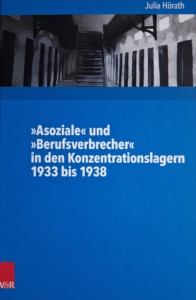
Forschung zur Kontinuität der sogenannten Frühen Konzentrationslager.
Erlass vom 28. Mai 1941 des Reichsführers SS Heinrich Himmler. Dieser Erlass sah vor, dass „Arbeitsverweigerer sowie arbeitsvertragsbrüchige und arbeitsunlustige Elemente“ in sogenannte „Arbeitserziehungslager“ gesperrt werden konnten. Diese waren ‚selbständige ‚Macht- und Terroreinrichtungen der regionalen Gestapostellen‘.“ (Pagenstecher, 2003, S. 76) Die Einrichtung von Arbeitserziehungslagern unter der Aufsicht der Gestapo bedeutete, dass „auf dem Gebiet der ‚Asozialen‘-Verfolgung die Gestapo 1941 mit einem eigenen Instrument zur terroristischen Erzwingung von Arbeitsdisziplin endgültig als Akteur neben die Kriminalpolizei“ (Hörath, 2017, S. 318) getreten war. Die Dauer des Aufenthalts war auf 56 Tage begrenzt. Derart, dass ein sogenannter „Zögling“ nach seiner Schicht nicht in sein Wohnlager oder in seine Wohnung zurückkehrte, sondern in das Arbeitserziehungslager, wo ihn Strafmaßnahmen, wie stundenlanges Exerzieren oder der sogenannte „Lagersport“, das heißt körperlich anstrengende Übungen gepaart mit Schlägen und weiteren Quälereien erwarteten.
Was die Akten über Haftgründe, Haftorte der „Asozialen“-Verfolgung aussagen
In einem Konzentrationslager mussten die Häftlinge Zwangsarbeit zum Zweck der Arbeitserziehung leisten. Auch die Zöglinge in einem Arbeitserziehungslager, sofern es Kriegsgefangene oder aus dem Ausland als Arbeitssklaven verschleppte Menschen, waren als Zwangsarbeitende eingesetzt. Wie mit diesen Menschen umgegangen wurde, die Haftgründe und Haftverläufe zeigen die Bedeutung von Arbeit im Nationalsozialismus, verstanden als Ausbeutung, das heißt Zwangsarbeit und damit „Vernichtung durch Arbeit“.
Das zeigt sich insbesondere, wenn man auf das Alter derjenigen schaut, die als sogenannte „Asoziale“ wegen mangelnder Arbeitsleistung in Konzentrationslager eingewiesen wurden. Ältere Männer, die oft durch Krankheiten oder körperliche Einschränkungen keiner regelmäßigen Arbeit mehr nachgehen konnten (oder wollten) erlagen sehr bald nach einer Einweisung den Strapazen der dort zu leistenden Zwangsarbeit. Es scheint wie eine zynische Maßnahme, um den reibungslosen Workflow in einem Betrieb von diesen, ihn gefährdenden Arbeitern bereinigen zu wollen. Diese wurden daraufhin in einem Konzentrationslager durch Auspressen ihrer letzten Arbeitskraft regelrecht vernichtet. Das galt vor allem für diejenigen, die in sogenannten „Steinbruchlagern“, das heißt Lagern, in denen ein Steinbruch in der Nähe war, eingeliefert worden waren. Dazu zählten die Konzentrationslager Natzweiler, Flossenbürg, Mauthausen, aber auch Buchenwald. Männer jenseits eines Lebensalters von 50, vor allem aber über 60 Jahren hatten dort keine Überlebenschance. Die meisten verstarben dort wenige Wochen nach ihrer Ankunft.
Jüngere Arbeitnehmer überstanden, sofern sie vor 1940 in ein Konzentrationslager eingewiesen wurden, in vielen Fällen die Haftzeit und kehrten nach ihrer Entlassung an ihren Wohnort zurück. Einige waren darunter, die nach ihrer Rückkehr sehr darauf achteten, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden. Während die Inhaftierung aus Anlass der Aktionen auf ein Jahr begrenzt war, veränderten sich die Haftbedingungen/Zeiten zusehends nach 1940/41 dahingehend, dass Einweisungen dauerhaft und lebenslang erfolgten. Das steht im Bezug zur Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern sowie einer zunehmenden Radikalisierung im Umgang mit „Gemeinschaftsfremden“. Nach Kriegsbeginn und im weiteren Verlauf des Krieges waren Entlassungen aus dem Konzentrationslager selten. Das galt vor allem für sogenannte „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Davon gibt der Haftweg von Alwin K. aus Blieskastel-Biesingen, einem 20-jährigen Arbeiter mit körperlicher Einschränkung Auskunft.
Alwin K. und wie aus Arbeitsbummelei eine Anklage wegen Arbeitssabotage wurde
Alwin K. brach sich als Kind einen Fuß. Der Bruch heilte nicht mehr richtig zusammen, worauf er körperlich eingeschränkt war und einen Spezialschuh tragen musste. Später arbeitete er als Scherengehilfe im Eisenwerk Alte Schmelz in St. Ingbert. Dort nahm man auf seine Behinderung keine Rücksicht. Da er große Schmerzen hatte, blieb er oft der Arbeit fern. (siehe dazu Mallmann/Paul, 1991, S. 315/316). Im Dezember 1941 war das mehrfach der Fall. Er wurde deshalb vom Arbeitsamt Neunkirchen verwarnt, blieb jedoch weitere Male der Arbeit fern. Daraufhin wurde er am 20. Januar 1942 von der Gestapo Saarbrücken verhaftet. „Um sein unwürdiges Verhalten während der Kriegszeit zu sühnen, erfolgt die Einweisung in das Sonderlager Hinzert“, lautete der Strafbefehl. Die Wahllosigkeit und Willkür, mit der Anschuldigungen erhoben wurden, zeigt sich daran, dass man ihm nicht „Arbeitsverweigerung“, sondern „Arbeitsvertragsbruch“ vorwarf. (LA SB, JVA.SB 10116) und deswegen über ihn Schutzhaft verhängte. Er wurde am 3. Februar 1942 für acht Wochen Arbeitserziehungshaft in das SS-Sonderlager Hinzert eingewiesen.

Auf die Fensterscheibe gebrannte Fotografie des ehemaligen Lagergeländes, von dem es heute keine Spuren mehr gibt.
Als Entlassungstermin wurde in dem Schreiben der Gestapo Saarbrücken (Arolsen Archives, DocID-453751) der 21. März 1942 genannt. Doch dazu kam es nicht. Alwin K. verlor nicht nur seine Freiheit, sondern bald darauf auch sein Leben.
Alwin K. war in Hinzert für das Zubereiten des Schweinefutters eingeteilt. Dafür musste er einen Kessel mit Kartoffeln auf dem Feuer kochen. Dabei unterlief ihm ein Missgeschick. Er ließ den Kessel ohne Wasser auf der Feuerstelle stehen, so dass er zersprang. Er wurde verwarnt, aber der Vorgang wiederholte sich, worauf er wegen „Sabotage im Arbeitslager“ angeklagt wurde. Drei Tage vor seiner Entlassung wurde der Strafbefehl von der Stapo Saarbrücken erlassen, worauf Alwin K. in Schutzhaft genommen wurde. Am 2. April 1942 kam er in das Gefängnis Sankt Wendel. Bis zu seiner Überführung in das Konzentrationslager Buchenwald am 15. Mai 1942 hatte man ihm dort Feldarbeit zugewiesen. (LA SB, JVA.SB 10116) In Buchenwald kam er in das Kabellegerkommando. „Arbeitsbummelei“ und „Arbeitsverweigerung“ wegen der er nach Hinzert gekommen war, bedeutet im Fall einer Überstellung in ein Konzentrationslager, dass er als sogenannter „Asozialer“ mit einem schwarzen Winkel markiert worden wäre. Die Anklage wegen „Sabotage im Arbeitslager“ (Arolsen Archives, DocID_453752) wurde jedoch als politischer Akt gewertet und Alwin K. wurde in der Häftlingspersonalkarte mit einem roten Winkel gekennzeichnet, den die politischen Häftlinge tragen mussten. Es war jedoch eher ein Akt der Willkür des Kommandanten, der die beiden Missgeschicke zu einer Handlung des politischen Widerstands erklärte.
Der SS-Mann Egon Zill war für seinen harten Umgang mit den Inhaftierten bekannt. Alwin K. kam in Hinzert in Haft, als Zill von Dezember 1941 bis April 1942 dort Kommandant gewesen war. Der als äußerst brutal geltende Zill war vormals Leiter des Konzentrationslagers Buchenwald gewesen. Der kostenlos in der ARD-Audiothek zum Download stehende Podcast „NS-Cliquen“ (Staffel 1, Episode 5: Egon und die mitteldeutschen Seilschaften) mit dem Geschichtswissenschaftler und führenden Experten in Sachen NS-Täter-Forschung, Dr. Stefan Hördeler informiert über die Biographie von Egon Zill und seiner Bedeutung im Gefüge der Tätergesellschaft im Nationalsozialismus.
In der Zeit des Nationalsozialismus war „Sabotage“ als Ausdruck einer widerständigen Arbeiterschaft eher Mythos denn Tatsache, lautet die Feststellung von Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul aufgrund ihrer Forschungen. Ihr Urteil ist eindeutig:
„Arbeitsbummelei und Sabotage waren innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung nie Kampfmittel gewesen und blieben daher auch während des Dritten Reichs die Ausnahme. Nur in wenigen Einzelfällen ist die Sabotage von Industrie- und Verkehrsanlagen überhaupt nachweisbar, wobei auch hier nicht immer klar ist, ob es sich dabei um vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, um natürlichen Verschleiß oder politisch motivierte Sabotage handelte. (…) Das Kampfmittel der Sabotage war nicht die Sache des deutschen Arbeiters.“ (Mallmann/Paul, 1991, S. 359)
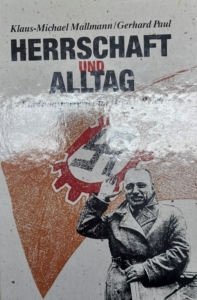
Zweiter Band der Reihe „Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935-1945“
Es war offenkundig auch nicht die Sache von Alwin K. gewesen. Er starb am 20. Januar 1943 im Alter von 21 Jahren im Konzentrationslager Buchenwald. Es gibt viele Fälle, in denen junge Frauen und Männer der Arbeitsbummelei bezichtigt wurde und auf unterschiedlichen Wegen und Orten der „Arbeitserziehung“ ausgeliefert waren. Am Ende stand für viele, gerade junger Männer der frühe Tod.
Verschiedene Haftwege nach Hinzert, aber immer ein Ziel: Der frühe Tod
Der Schmied Johann K. stammte vom Baltersbacher Hof bei Wiebelskirchen aus einer Familie von Arbeitern und Tagelöhnern, wie aus dem Einwohnerverzeichnis der Gemeinde Wiebelskirchen aus dem Jahr 1949 hervorgeht Auch er wurde zur „Arbeitserziehung“ am 17. April 1942 in das SS-Sonderlager/KZ Hinzert eingewiesen. Als Haftgrund wurde angegeben: „K. ist ein großer Bummelant und hat seit dem 11.3.1942 überhaupt nicht mehr gearbeitet. Da er mit seiner Festnahme rechnete, hielt er sich nicht zuhause auf und trieb sich vagabundierend umher.“ (Arolsen Archives DocID_453669)
Es genügte, einen Monat der Arbeit fern zu bleiben, um erfasst, verurteilt und ihn ein Arbeitserziehungslager eingewiesen zu werden. Johann K. überstand die acht Wochen in Hinzert und kam wieder frei. Doch ein Jahr danach war bereits ein Todesurteil über ihn verhängt worden. Er war zur 21. Flak-Division einberufen worden. Sie hatte zur Aufgabe gegnerische Flugzeuge abzuwehren. Sie bestand zwischen März 1943 und 1945 und erstreckte sich über die heutigen Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. Seit Ende 1940 gehörte auch Saarbrücken zu deren Zuständigkeitsbereich. Es ist anzunehmen, dass er dem in Saarbrücken stationierten Flak-Regiment 169 in Saarbrücken zugeteilt worden war.
Eine seinen Namen tragende Häftlingsakte hat sich im Hessischen Hauptstaatsarchiv erhalten (HHStAW, 409/3, 15130). Darin wird jedoch als Geburtsdatum der 17.09.1917 und der Geburtsort Wiebelskirchen angegeben. Das Geburtsdatum ist falsch, da Johann K. am 07.10.1917 geboren wurde. Die einweisende Behörde war das Feldgericht der 5. Flak-Division Frankfurt. Als Johann K. vorgeworfenes Delikt wurde „Fahnenflucht“ (Aktenzeichen K ST L 750/42) genannt. Auch hier kann ein verspätetes Eintreffen oder ein Fehlen am Einsatzort zu einem solchen Vorwurf geführt haben.
Johann K. wurde offensichtlich gefasst, verhaftet und kam in die Untersuchungshaftanstalt in der Hammelgasse in Frankfurt/Main. Aus einem in den Arolsen Archives erhaltenen Dokument (Arolsen Archives, DocID_70507286) geht hervor, dass er aufgrund eines Urteil des Feldgerichts vom 10.05.1943 zum Tod verurteilt worden war. Die Hinrichtung erfolgte am 07.08.1943. Bekannt ist jedoch, dass solche Verfahren vor einem alles andere als nach den Normen eines Rechtsstaates folgenden „Gerichtes“ nur den Freispruch oder die Todesstrafe verhängten. Alwin K. starb mit 21 Jahren. Johann K. war zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung 25 Jahre alt.
Literatur:
- Wolfgang Benz: Deutsche Gesellschaften und ihre Außenseiter. In: Gemeinschaftsfremde. Berlin 2016.
- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.
- Klaus-Michael Mallmann, Gerhard Paul: Reihe „Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935-1945. Hg. von Hans-Walter Herrmann. Band 2: Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich. Bonn 1991. Zu Alwin K., S. 315, 358.
- Frank Nonnenmacher (Hg.): Die Nationalsozialisten nannten sie „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Verfolgungsgeschichten im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik. Frankfurt 2024.
- Cord Pagenstecher: Arbeitserziehungslager Fehrbellin. Zwangsarbeiterinnen im Straflager der Gestapo. Hrsg. von der Berliner Geschichtswerkstatt (Brandenburgische Historische Hefte der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung, 17) Potsdam 2004.
- Elisabeth Thalhofer: Das Lager Neue Bremm. Terrorstätte der Gestapo. St. Ingbert 2002. Erw. Neuauflage 2019.