Der Weg von dem Gestapo-Lager in ein Konzentrationslager war nicht ungewöhnlich. Das zeigt der Fall des wegen Heimtücke-Vergehens im Gestapo-Lager Neue Bremm inhaftierte Nikolaus A. aus Niedersalbach.
Der 33-jährige Nikolaus A. aus Niedersalbach wurde am 26. August 1944 in Völklingen wegen Verstoß gegen das Heimtückegesetz, Zersetzung der Wehrkraft und Beleidigung der Reichsregierung verhaftet. Ihm wurden mehrere Aussagen zur Last gelegt. So soll er das Attentat vom 20. Juli 1944 mit den Worten „Sie haben die Falschen aufgehängt“ kommentiert haben. (Quelle: LA SB LEA 17991) Auch soll er vor anderen den erfolgreichen Fortgang des Krieges bezweifelt haben und dessen Ende mit den Worten „wenn man nichts mehr hat, soll man mit dem Krieg Schluss machen“ (Quelle: LA SB LEA 17991, Blatt 4) eingefordert haben. Als Haftgrund wurde jedoch „wegen Bummelei auf der Arbeitsstelle“ angegeben. Damit war der Gestapo ein weiterer Anlass zur Haft und einer dauerhaften Unterbringung in einem Lager jederzeit möglich. Haftgründe wie „Arbeitsbummelei“ oder „Arbeitsverweigerung“ führten bereits seit 1933, insbesondere im Zusammenhang mit der zwischen April und Juli 1938 durchgeführten „Aktion Arbeitsscheu Reich“ oder „Aktion Arbeitszwang Reich“ zu Einweisungen in ein Konzentrationslager.
Die Verfolgung und Verhaftung oblag dabei der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern oder den Sozialbehörden. Die Gestapo trat als weiterer Akteur auf diesem Gebiet im Jahr 1941 „mit einem eigenen Instrument zur terroristischen Erzwingung von Arbeitsdisziplin endgültig als Akteur neben die Kriminalpolizei.“ (Hörath 2017, 318).
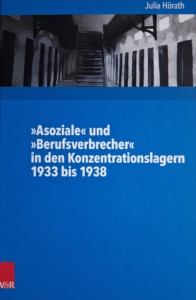
Forschung zur Kontinuität der Verfolgung der sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ seit der Entstehung der Frühen Konzentrationslager im Jahr 1933.
Die Voraussetzung dazu war mit dem Erlass vom 28. Mai 1941 des Reichsführers SS Heinrich Himmler geschaffen worden. Er sah vor, dass „Arbeitsverweigerer sowie arbeitsvertragsbrüchige und arbeitsunlustige Elemente“ in sogenannte „Arbeitserziehungslager“ gesperrt werden konnten. Diese unterstanden nicht der Inspektion der Konzentrationslager (IKL), sondern wurden jeweils von der örtlichen Gestapo betrieben. Sie erwiesen sich als rechtsfreie Räume, genauer als „Terrorstätte der Gestapo“ (Elisabeth Thalhofer), wozu auch das im Juli 1943 in Betrieb genommene Lager Neue Bremm zählte.
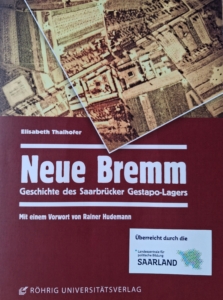
Erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gestapo-Lager Neue Bremm
Häufiges Zuspätkommen, Fehlen wegen einer Erkrankung oder vermeintlich ein zu langsames Arbeiten oder Verhaltensweisen, die dem Vorgesetzten nicht passten, wurden nun mit der Einweisung in ein Arbeitserziehungslager bestraft. Das Lager Neue Bremm war ein solches Lager mit mehreren Funktionen: Es war nicht nur Durchgangslager für die Frauen und Männer des Widerstands aus Frankreich, sondern auch Arbeitserziehungslager für Zwangsarbeitende aus Osteuropa, die in Saar-Industrie eingesetzt wurden sowie für Saarländerinnen und Saarländer, die man ebenfalls der Arbeitsverweigerung oder Arbeitsbummelei verdächtigte.
Die politische Dimension des Vorwurfs der „Arbeitsbummelei“ und der „Arbeitsverweigerung
Neu war, dass diese Beschuldigungen nicht länger durch die Kriminalpolizei verfolgt wurden, sondern seit 1941 durch die dazugekommenen Befugnisse der Gestapo auch eine politische Dimension erhielten: Arbeitsbummelei oder Arbeitsverweigerung konnte nun als „Sabotage“ ausgelegt und damit als politischen Verbrechen angesehen werden. Das war jedoch oft eine vorgeschobene Behauptung, um ein Vergehen als politische Tat zu rechtfertigen. Nikolaus A. kam wegen „Arbeitsbummelei“ am 26. August 1944 in das Gestapo-Lager Neue Bremm. Das hatte Folgen für den weiteren Verlauf seiner Haft. Der Faktor Empathie war hier durch den der Ideologie ersetzt. Er bekam keine Hilfe von außen, sondern wurde in einer Zeit, als sich das Lager bereits in Auflösung befand, am 3./4. September 1944 mit 54 im Gestapo-Lager Neue Bremm inhaftierten Franzosen und weiteren Deutschen in einem Transport in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Er erhielt die Häftlingsnummer 98208 und wurde, versehen mit einem roten Winkel, also als politischer Gefangener in Schutzhaft genommen. (Quelle: LA SB LEA 17991, Blatt 8). Er blieb in Sachsenhausen bis Februar 1945.
Von dort gelangte er in das Konzentrationslager Mauthausen, Häftlingsnummer 1333587. In Mauthausen bei Linz/Österreich war eines der sogenannten „Steinbruch-Lager“. Das heißt, wie in Natzweiler oder Flossenbürg gab es einen Steinbruch, in dem die Häftlinge Schwerstarbeit leisten mussten und Steinquader auf ihrem Rücken über eine lange in den Stein geschlagene Treppe, die „Todesstiege“ genannt wurde, nach oben schleppen. Unzählige Männer erlagen diesen Strapazen, und das zu einem Zeitpunkt, als sich gegen Kriegsende die Konzentrationslager aufgrund der bereits aufgelöster Lager immer mehr füllten. Es herrschten unvorstellbare hygienische Zustände und großes Elend unter den Inhaftierten. Für Nikolaus A. verschärfte sich die KZ-Haft, als er vom 21. März bis zum 25. April 1945 in das Kommando Gusen überführt wurde, zu dem wiederum Steinbrüche gehörten. Nach erneuter Überstellung in das Hauptlager Mauthausen blieb Nikolaus A. dort bis zur Befreiung des Lagers am 4. Mai 1945.
Als Nikolaus A., der zwei Konzentrationslager durchgestanden hatte, 1947 um eine Anerkennung als „Opfer der Nationalsozialismus“ einkam, wurde er abgewiesen. Diese Anerkennung war eine notwendige Voraussetzung war, um eine finanzielle Entschädigung für die entstandenen körperlichen und wirtschaftlichen Schäden beantragen zu können. Über die Anerkennung entschied ein Komitee, dem auch Männer angehörten, die selbst im Nationalsozialismus als Kommunisten verfolgt und inhaftiert worden waren. Anstatt Empathie erwartete Nikolaus A. jedoch erneut Ideologie. Als Mitglied des Windhorst-Bundes, der Jugendorganisation der katholischen, aber von den Nationalsozialisten verbotenen Zentrumspartei fand er bei den politisch andersdenkenden Mitgliedern des Ausschusses kein Verständnis. Sein Antrag wurde abgelehnt. Zwei Jahre danach, 1949 wurde der Beschluss aufgehoben, so dass er Entschädigung für das erfahrene Leid beantragen konnte. Die Anzahl der Wirkfaktoren vermag die Einweisung in ein Konzentrationslager zu verhindern. Ein anderes, in einem weiteren Eintrag vorgestelltes Beispiel zeigt, was es bedeutet, wenn Empathie und Pragmatismus dem Faktor Ideologie gegenüberstehen.
Literatur:
- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.
- Elisabeth Thalhofer: Das Lager Neue Bremm. Terrorstätte der Gestapo. St. Ingbert 2002. Erw. Neuauflage 2019.