Das Beispiel der 23-jährigen Margot H. aus Saarbrücken zeigt, dass Heimtücke kein Vergehen war, dass allein Männern vorbehalten blieb.
Die 23-jährige Margot H. wurde 1944 wegen Vergehen gegen das Heimtückegesetz angeklagt. Auf ihrer Arbeitsstelle der Firma Dingler & Karcher in Saarbrücken hatte sie ihren Kolleginnen und Kollegen von den Zuständen in den Konzentrationslagern berichtet. Sie sprach von der Praxis von SS-Aufsehern, die Häftlingen ihre Mütze entrissen und in Richtung Lagerzaun warfen. Daraufhin musste der Häftling die Mütze am Zaun holen, was ihm als Fluchtversuch ausgelegt wurde. Dann durfte auf ihn geschossen werden. Für einen auf diese Weise ermordeten Häftling erhielte ein SS-Mann sieben Tage Sonderurlaub. Daher war dieses Vorgehen unter SS-Aufsehern gebräuchlich, erklärte Margot H. am 2. Februar 1944 auf ihrer Arbeitsstelle. Sie wurde denunziert und noch am selben Tag verhaftet.
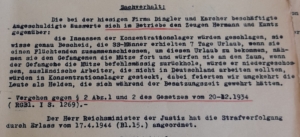
Der Grund für die Anklage von Margot H. wegen Heimtücke-Vergehen. Quelle: LA SB, LEA 12024
Direkt nach ihrer Verhaftung kam sie in das Gestapo-Lager Neue Bremm. Am nächsten Tag wurde sie dem Haftrichter vorgeführt. Dabei kam der Faktor Empathie zum Tragen, denn der Haftrichter kannte sie und erließ umgehend einen Haftbefehl. Auf diese Weise war sie dem Einfluss der Gestapo entzogen. Damit war die Gefahr einer Überstellung in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück behoben.
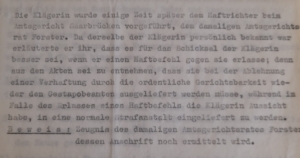
Der rechtliche Spielraum des Haftrichters von Margot H. rettete sie vor dem Konzentrationslager. Quelle: LA SB, LEA 12024
Denn in diesem Zeitraum war das Frauenlager des Lagers Neue Bremm bereits in Betrieb. Von dort wurden die aus Frankreich nach Saarbrücken gebrachten Frauen des französischen Widerstands nach einigen Tagen Aufenthalt in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Die im Lager inhaftierten Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa, die man wegen Arbeitsbummelei, Arbeitsverweigerung, was in den Jahren 1943 und 1944 als „Sabotage“ galt, von ihrem Arbeitsplatz in der Saar-Industrie in das Lager Neue Bremm eingewiesen worden waren, wurden ebenfalls mit auf Transport nach Ravensbrück geschickt. Viele verloren dort ihr Leben verloren.
Gefängnishaft statt Überführung in ein Konzentrationslager
Margot H. verblieb noch bis zum 17. Februar 1944 im Lager und wurde dann ins Gefängnis Lerchesflur überstellt. Im Mai 1944 kam sie vor das Sondergericht und wurde wegen Vergehen gegen das Heimtückegesetz zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Sie wurde am 4. Oktober 1944 aus dem Gefängnis entlassen und die Reststrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.
Sie merkte zu ihrer Verteidigung an, dass ihr Verlobter im Konzentrationslager Buchenwald war und sie daher auf die Zustände dort aufmerksam machen wollte. Seine Verhaftung war im Juni 1943 in ihrer Wohnung in der Saarbrücker Uhlandstraße erfolgt. Er konnte mit Hilfe eines Kellners des Ufa-Kellers in Saarbrücken, der ihm mit Geld und sauberer Kleidung half, aus dem gerade im Aufbau befindlichen Gestapo-Lager Neue Bremm fliehen. Der Verlobte wurde jedoch gefasst und von Saarbrücken aus in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. (Quelle: LA SB LEA 12024, JVA.SB 18355)
Diese Information über den Umgang mit Häftlingen in einem Konzentrationslager konnte sie nicht von ihrem Verlobten haben. Zumindest nicht aus seiner Zeit im Konzentrationslager Buchenwald. Roland H. war zuvor in der Zeit um 1940 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Neuengamme in Haft gewesen, aber daraus, was selten genug war, wieder freigekommen. Nach seiner Rückkehr nach Saarbrücken um das Jahr 1942 hatte er Margot H. kennengelernt.
Die von ihm erhaltenen Briefe auf Buchenwald enthielten keine solchen Angaben, denn alle Briefe (Quelle: Privatbesitz) auf einem Konzentrationslager unterlagen der Zensur. Auch ihr Verlobter Roland H. berichtete nichts über die Zustände dort, sondern schrieb gefühlvoll über die gemeinsame Zukunft des Paares. Beide heirateten nach der Befreiung des Lagers am 26. Mai 1945 in der Nähe von Buchenwald.

Margot H. wurde wegen Heimtücke-Vergehen zu Gefängnis verurteilt
Die Empathie eines Bekannten, der seinen Einfluss als Jurist im örtlichen NS-Strafsystem nutzte, bewahrte Margot H. vor der Haft in einem Konzentrationslager, genauer in Ravensbrück. Dieses Lager war zu diesem Zeitpunkt wie die meisten großen Konzentrationslager überfüllt war und die Chancen, diesen Ort des Terrors unbeschadet zu überstehen, zusehends kleiner wurden. Wäre sie im Einflussbereich der Gestapo geblieben, wäre die Überführung in ein Konzentrationslager mit einem der Transporte der im Gestapo-Lager Neue Bremm für mehrere Tage inhaftierten Französinnen nach Ravensbrück wahrscheinlich gewesen.